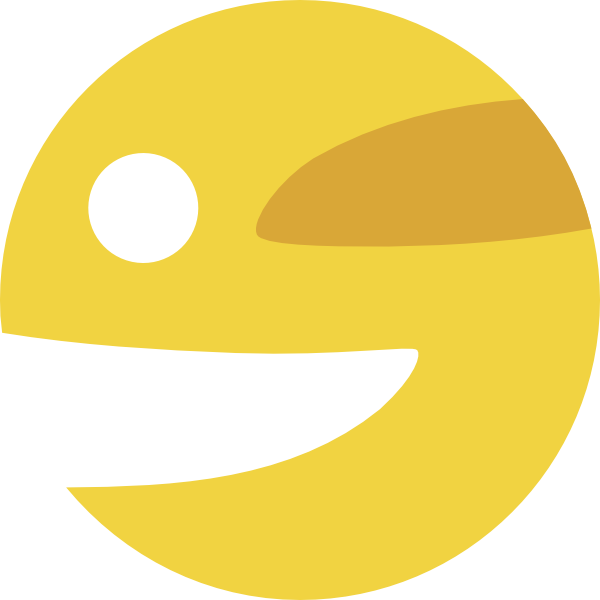Stadtstromer • Wir zeigen Euch Leipzig einzigartig innovativ!
So habt ihr eine Stadt noch nie erlebt! ❯ zu Fuß • mit Segway • mit Scuddy!
Von den Gästen bestbewertet, deshalb auch für Euch die beste Wahl!
Leipzig wartet auf Euch! Entdeckt die faszinierende Stadt spannend und abwechslungsreich – ob innovative Stadtführung zu Fuß, Segway-Tour oder Scuddy-Fahrspaß: wir haben für jeden Geschmack und jedes Tempo die perfekte Tour.
Mit unseren einzigartigen Stadtführungen lernt ihr die Innenstadt mit ihren historischen und kulturellen Highlights kennen, stromert mit dem Segway zu den besten Aussichtspunkten und Sehenswürdigkeiten der Stadt oder genießt den puren Fahrspaß mit dem fortschrittlichen Scuddy, dem elektrischen Roller, der euch überall hinbringt. Bei uns kommt garantiert keine Langeweile auf!
Worauf wartet ihr noch? Bucht jetzt eure Wunschtour und erlebt Leipzig wie nie zuvor mit Stadtstromer!
Treff und Start aller unserer Touren
Alle Touren starten in unserem „Stadtstromer“-Geschäft im Center „Höfe am Brühl“ mitten in der Leipziger Innenstadt.
Wir haben einen eigenen Außenzugang zwischen den beiden Center-Gebäuden. Die Touren enden an der gleichen Stelle.
Richard-Wagner-Straße 13 (am Fuß-/Radweg)
04109 Leipzig
Auf der Karte ist es an der richtigen Stelle markiert:
International
🇬🇧 Our experiences in Leipzig on foot, with Segway or Scuddy are also available in English upon request.
🇪🇸 Nuestras experiencias en Leipzig a pie, en Segway o Scuddy también están disponibles en español bajo petición.
🇸🇰 Naše zážitky v Lipsku pešo, na Segway alebo Scuddy sú na vyžiadanie dostupné aj v slovenskom jazyku.
🇩🇪 Unsere Erlebnisse gibt es auch in englisch, spanisch und slowakisch.
Vielfältig und nachhaltig!
Wir sind sehr stolz darauf, Euch mit unserem internationalen Team so tolle Erlebnisse in Leipzig zu zaubern! Wir freuen uns sehr, wenn auch unsere Gäste genauso wissbegierig, vielfältig & weltoffen sind.
Unser Stadtrundgang ist barrierefrei, seid beim JGA in Leipzig gern queer und bei allen Erlebnissen achten wir zudem auf Nachhaltigkeit.
Möchtest auch Du Stadtstromer-Guide werden und suchst nach einem Nebenjob in Leipzig?